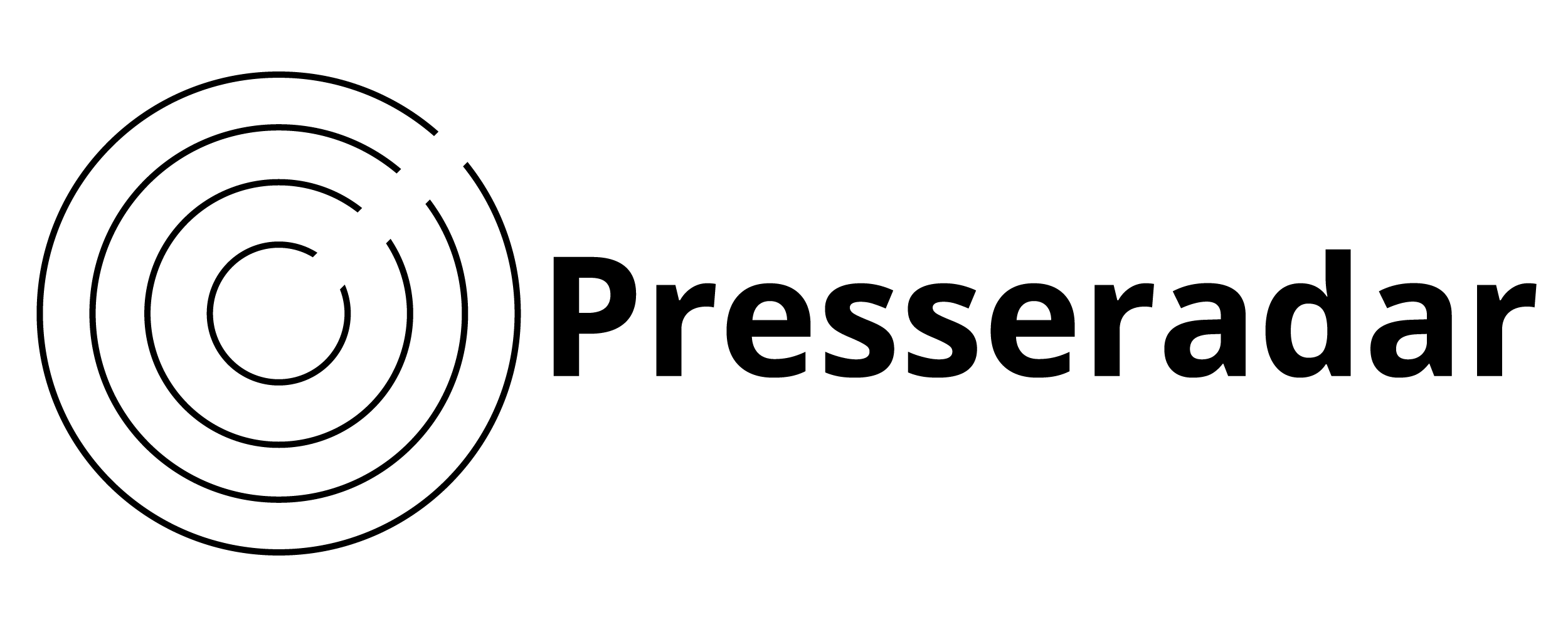Die Zielkonflikte innerhalb der Ampelkoalition waren lange bekannt. Besonders bei den zentralen Themen der Wirtschaftspolitik und der Finanzierung des Haushalts lagen die Ansichten der drei Partnerparteien teils deutlich auseinander. Streitigkeiten über Subventionen, Investitionsprogramme und die Zukunft der deutschen Industrie verschärften sich vor allem in den letzten Monaten. So hielten SPD, Grüne und FDP jeweils im Alleingang unterschiedliche Gipfeltreffen ab, um mit verschiedenen Teilen der Industrie zu sprechen – oft in wechselnden Konstellationen. Diese Uneinigkeit spiegelte nicht nur die unterschiedlichen politischen Ansätze wider, sondern verstärkte auch das Misstrauen zwischen den Koalitionspartnern. Entscheidender Faktor war, dass die wirtschaftliche Verfassung des Landes die politische Lage bereits seit geraumer Zeit belastetet hat. Deutschland befindet sich bereits im zweiten Jahr einer Rezession und besonders alarmierend ist die seit 2017 anhaltende Industrierezession. Sinkende Produktionszahlen, steigende Energiepreise und zunehmender internationaler Wettbewerb setzen die deutsche Wirtschaft unter Druck. Erst im November 2024 schraubte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung („die Wirtschaftsweisen“) das prognostizierte Wachstum für die Bundesrepublik um mehr als die Hälfte auf gerade einmal 0,4 Prozent herunter, nachdem bereits für 2024 mit einem realen BIP-Rückgang von 0,1 Prozent gerechnet wurde.
Anstatt eine gemeinsame Linie zu finden, um dieses Problem anzugehen, setzten die Parteien auf wirtschaftspolitische Alleingänge. Ein Wirtschaftspapier der FDP, das kurz vor der Eskalation an die Öffentlichkeit gelangte, und die in dem Zusammenhang geführte Debatte über den Bundeshaushalt brachte das Fass schließlich zum Überlaufen und Bundeskanzler Olaf Scholz reagierte mit der Entlassung von Finanzminister Christian Lindner. Dieser Schritt führte zum Austritt der FDP aus der Koalition – ein Schritt, der die Bundesregierung ihrer parlamentarischen Mehrheit und damit letztlich auch ihrer Handlungsfähigkeit beraubte. Die Opposition, allen voran die CDU unter Friedrich Merz, machte schnell nach dem Bruch deutlich, dass sie der gescheiterten Ampelregierung keine Unterstützung leisten werde. Merz kündigte einen „CDU pur“-Wahlkampf an und distanzierte sich von der Industriepolitik der Ampel.
Mit dem Bruch der Koalition steht Deutschland bis zum Antritt einer neuen Bundesregierung faktisch ohne handlungsfähige Industriepolitik da. Jede Partei versucht nun, sich im Wahlkampf mit einem eigenen wirtschaftspolitischen Kurs zu profilieren, was Mehrheitsentscheidungen im Bundestag nahezu unmöglich macht. Dies bedeutet auch, dass dringend notwendige Entscheidungen – etwa zu Investitionen in die Infrastruktur oder zur Entlastung der Unternehmen – bis auf Weiteres auf Eis gelegt sind.
Mögliche Szenarien
Die Zukunft der deutschen Industriepolitik hängt nun entscheidend von den kommenden Wahlen ab. Derzeit deuten die Umfragen auf zwei mögliche Szenarien hin: eine Neuauflage der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD oder eine schwarz-grüne Regierung.
Beide Optionen werden von den unterschiedlichen Lagern kritisch betrachtet. Merz bemüht sich, die CDU von der Politik der Großen Koalition unter Angela Merkel abzugrenzen, dennoch sehen Kritiker in einer solchen Konstellation die Gefahr eines erneuten Stillstands, wie er die Ära Merkel in den verganenen Jahren prägte. Sollte es zu einer schwarz-grünen Koalition kommen, könnte ein Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck die wirtschaftspolitische Linie der Ampel weiterführen – eine Perspektive, die insbesondere konservative Stimmen skeptisch sehen. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, spricht sich vehement gegen ein Bündnis mit den Grünen auf Bundesebene aus und drohte sogar damit, ein solches mit einem Veto zu blockieren. Die FDP versucht derweil, sich als unverzichtbarer Partner für einen wirtschaftlichen Neustart zu positionieren. Angesichts ihrer aktuellen Umfragewerte und des Vertrauensverlusts ihres Vorsitzenden Christian Lindner erscheint dies jedoch ambitioniert. Lindners Rolle beim mutmaßlich gezielten Scheiternlassen der Ampel hat nicht nur das Ansehen der FDP sondern auch seine persönliche Popularität stark beschädigt.
Neue Legislatur, neue Chancen?
Neben den Parteien bereiten sich auch Wirtschaftsverbände und Unternehmen bereits auf die kommende Legislaturperiode und eventuelle Regierungskonstellationen vor. Einigkeit besteht darüber, dass künftig mehr Entlastungen für die Wirtschaft notwendig sind. Der Abbau von Bürokratie hat sich dabei zum zentralen Schlagwort entwickelt. erz beispielsweise hat bereits angekündigt, künftig EU-Vorgaben ohne zusätzliche nationale Anforderungen („Goldplating“) umzusetzen. Auch von Seiten der EU, die im Dezember mit einer neuen Kommission unter Ursula von der Leyen an den Start gegangen ist, stehen alle Zeichen auf Bürokratieabbau. Ob sich dieses vielerorts gemachte Versprechen nun in den kommenden Jahren bewahrheitet oder der erwartete Abbau wieder neue bürokratische Verfahren einführt bleibt abzuwarten.
Trotz und gerade wegen der politischen Unsicherheiten bringt der ZVO seine Anliegen weiter in den politischen Prozess ein. Ziel ist es, Prozesse frühestmöglich zu begleiten und auch in der kommenden Phase der Koalitionsverhandlungen die Interessen der Galvanikbranche zu vertreten und damit die Weichen für ein wirtschaftsfreundliches Umfeld zu stellen. So hat der ZVO bereits früh begonnen, sein Netzwerk für die kommende Legislaturperiode auszubauen und auch bereits erste Akzente durch das Einbringen der Verbandssicht bei Aufrufen zur Beteiligung an Wahlprogrammen gesetzt. An diesen Schritten wird er weiter anknüpfen.
Das vor uns liegende Jahr wird politisch ereignisreich. Eine neue EU-Kommission nimmt ihre Arbeit auf und steckt mit diversen 100-Tages-Programmen den Rahmen der europäischen Wirtschaftspolitik für die kommenden fünf Jahre ab. Zeitgleich bekommt Deutschland eine neue Bundesregierung. In solch turbulenten Zeiten wird der ZVO sich kontinuierlich dafür einsetzen, dass die Stimme des Mittelstands und insbesondere die der Galvanikbranche gehört wird und sicherstellen, dass diese weiter als verlässlicher Ansprechpartner und Impulsgeber für die Politik zur Verfügung steht.
Zentralverband Oberflächentechnik e.V.
Giesenheide 15
40724 Hilden
Telefon: +49 (2103) 2556-21
Telefax: +49 (2103) 2556-25
http://www.zvo.org
PR
Telefon: +49 (2103) 255621
Fax: +49 (2103) 255632
E-Mail: b.spickermann@zvo.org
![]()